Wie gelingt es, die Zuweisung für Schutzsuchende und Kommunen passgenauer zu gestalten?
Mit dem Pilotprojekt „Match’In“ verfolgten die FAU Erlangen-Nürnberg und die Universität Hildesheim in den letzten vier Jahren das Ziel, das behördliche Zuweisungsverfahren mithilfe eines algorithmengestützen Matchings gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern aus der Praxis passgenauer zu gestalten.
Beteiligt waren daran neben der FAU die Universität Hildesheim sowie die zuständigen Ministerien und weitere Partnerinnen und Partner in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Mercator.
Neben der gemeinsamen Entwicklung des Matchings und seiner praktischen Erprobung wurde das Projekt von den beiden Universitäten wissenschaftlich begleitet. Der Fokus lag auf der Frage, welche Aspekte bei der Implementierung des neuen Verfahrens – auch in den unterschiedlichen Kontexten der Bundesländer – relevant waren. Die Ergebnisse liefern einen Einblick in die Entwicklungs- und die Pilotierungsphase. Im Rahmen einer Technikfolgenabschätzung wurden (mögliche) Folgen des Einsatzes eines digitalen Tools für den Bereich der Zuweisung von Schutzsuchenden diskutiert.
Die Ergebnisse dieser Begleitforschung sind nun in einem Policy Paper veröffentlicht.
Das wissenschaftliche Projektteam der beiden Universitäten kam dabei zu folgenden zentralen Erkenntnissen:
1. Match’In zeigt, dass Kommunen für unterschiedliche Personen tatsächlich unterschiedlich gut „passen“. Die Zuweisung über Match’In ist somit passgenauer als eine überwiegend zufallsorientierte.
2. Match’In ermöglicht den Einbezug von rund 60 Kriterien in den Zuweisungsprozess. Dadurch passt die Verwaltungsentscheidung deutlich besser zur komplexen Realität der Migration. Staatliches Handeln wird zielgenauer und effizienter.
3. Match’In wurde im normalen Zuweisungsverfahren der beteiligten Bundesländer erfolgreich getestet. Damit ist eine zentrale Voraussetzung für die Ausweitung auf das gesamte Zuweisungssystem erfüllt. Gleichzeitig kann das bislang aufwändige Verfahren der Datenerfassung noch optimiert werden.
4. Match’In sorgt für erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. Warum eine Zuweisung an einen bestimmten Ort vorgenommen wird und welches Verfahren dahintersteckt, ist für die entsprechenden Kommunen und Schutzsuchenden nun plausibler.
5. Match’In gibt Sicherheit bei der Ausübung von pflichtgemäßem Ermessen. Mitarbeitende in den Zuweisungsbehörden erhalten breitere Informationen zu beiden Seiten und können ihr Ermessen systematischer und umfassender informiert ausüben.
6. Match’In genießt eine breite Akzeptanz unter sehr unterschiedlichen Akteuren, und zwar sowohl bei Personen, die dem Verfahren von Beginn an offen gegenüberstanden, als auch bei Personen, die zu Beginn eher skeptisch gegenüber einer technischen Lösung eingestellt waren. Vor allem die Kommunen begrüßen den bislang unüblichen Einbezug ihrer Perspektiven in Verteilentscheidungen.
Im Detail sind die Ergebnisse im Policy Paper nachzulesen:
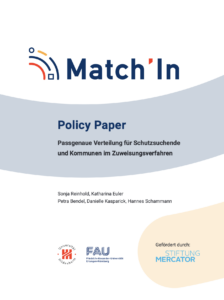
Weiterführende Informationen finden sich auf der Match’In Projekt-Homepage.

Wie gelingt es, die Zuweisung für Schutzsuchende und Kommunen passgenauer zu gestalten?
Mit dem Pilotprojekt „Match’In“ verfolgten die FAU Erlangen-Nürnberg und die Universität Hildesheim in den letzten vier Jahren das Ziel, das behördliche Zuweisungsverfahren mithilfe eines algorithmengestützen Matchings gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern aus der Praxis passgenauer zu gestalten.
Beteiligt waren daran neben der FAU die Universität Hildesheim sowie die zuständigen Ministerien und weitere Partnerinnen und Partner in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Gefördert wurde das Projekt von der Stiftung Mercator.
Neben der gemeinsamen Entwicklung des Matchings und seiner praktischen Erprobung wurde das Projekt von den beiden Universitäten wissenschaftlich begleitet. Der Fokus lag auf der Frage, welche Aspekte bei der Implementierung des neuen Verfahrens – auch in den unterschiedlichen Kontexten der Bundesländer – relevant waren. Die Ergebnisse liefern einen Einblick in die Entwicklungs- und die Pilotierungsphase. Im Rahmen einer Technikfolgenabschätzung wurden (mögliche) Folgen des Einsatzes eines digitalen Tools für den Bereich der Zuweisung von Schutzsuchenden diskutiert.
Die Ergebnisse dieser Begleitforschung sind nun in einem Policy Paper veröffentlicht.
Das wissenschaftliche Projektteam der beiden Universitäten kam dabei zu folgenden zentralen Erkenntnissen:
1. Match’In zeigt, dass Kommunen für unterschiedliche Personen tatsächlich unterschiedlich gut „passen“. Die Zuweisung über Match’In ist somit passgenauer als eine überwiegend zufallsorientierte.
2. Match’In ermöglicht den Einbezug von rund 60 Kriterien in den Zuweisungsprozess. Dadurch passt die Verwaltungsentscheidung deutlich besser zur komplexen Realität der Migration. Staatliches Handeln wird zielgenauer und effizienter.
3. Match’In wurde im normalen Zuweisungsverfahren der beteiligten Bundesländer erfolgreich getestet. Damit ist eine zentrale Voraussetzung für die Ausweitung auf das gesamte Zuweisungssystem erfüllt. Gleichzeitig kann das bislang aufwändige Verfahren der Datenerfassung noch optimiert werden.
4. Match’In sorgt für erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens. Warum eine Zuweisung an einen bestimmten Ort vorgenommen wird und welches Verfahren dahintersteckt, ist für die entsprechenden Kommunen und Schutzsuchenden nun plausibler.
5. Match’In gibt Sicherheit bei der Ausübung von pflichtgemäßem Ermessen. Mitarbeitende in den Zuweisungsbehörden erhalten breitere Informationen zu beiden Seiten und können ihr Ermessen systematischer und umfassender informiert ausüben.
6. Match’In genießt eine breite Akzeptanz unter sehr unterschiedlichen Akteuren, und zwar sowohl bei Personen, die dem Verfahren von Beginn an offen gegenüberstanden, als auch bei Personen, die zu Beginn eher skeptisch gegenüber einer technischen Lösung eingestellt waren. Vor allem die Kommunen begrüßen den bislang unüblichen Einbezug ihrer Perspektiven in Verteilentscheidungen.
Im Detail sind die Ergebnisse im Policy Paper nachzulesen:
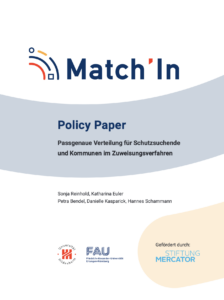
Weiterführende Informationen finden sich auf der Match’In Projekt-Homepage.